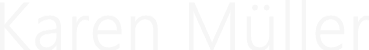Laudatio von Peter Schmitt zur Retrospektive

Laudatio Karen Müller
anlässlich der Retrospektive im Porzellanikon Hohenberg, 23. Januar 2015
Heute hier stehen und zu Ihnen sprechen zu dürfen, erfüllt mich aus zwei Gründen mit besonderer Freude. Da ist einmal das Porzellanikon selbst, dessen Werden ich – meistens aus der Ferne, denn von Karlsruhe hierher ist nicht gerade ein Katzensprung – aber doch stets mit Interesse verfolgt habe. Ich habe seine Anfänge als Museum der Deutschen Porzellanindustrie hier in Hohenberg miterlebt. Ich habe gesehen, wie es gewachsen ist, andere Namen angenommen hat, um schließlich am Ende seiner Metamorphosen als Staatliches Museum für Porzellan einen angesehenen Platz in der europäischen Museumslandschaft einzunehmen. Unter seinem Dach, oder genauer unter seinen verschiedenen Dächern vereint es alle Aspekte des Werkstoffs Porzellan, technische, wirtschafts- und sozialgeschichtliche und – von Anfang an – auch künstlerische. Ich bedanke mich also bei Herrn Siemen herzlich für seine Einladung – und erinnere mich dabei gern an unser erstes Zusammentreffen Anfang der 1980er Jahre: „Arzberg 1382 – Eine Form, die Geschichte macht“, eine Ausstellung, die, wie der Design-Klassiker, den sie feierte, auch längst Geschichte ist.
Aber
damit bin ich abgeschweift. Ich sagte ja, ich hätte einen zweiten Grund,
weshalb ich mich über die Einladung freue, heute hier vor Ihnen sprechen zu
dürfen. Das ist die Künstlerin, die Ihnen vorzustellen ich heute die Ehre habe.
Nun, vielleicht muss ich sie gar nicht vorstellen, weil Sie, meine Damen und Herren,
Arbeiten von ihr bereits in anderem Kontext gesehen haben; aber eine
umfangreiche Retrospektive, wie sie heute geboten wird und wie es sie bisher
noch nicht gegeben hat, sollte doch Anlass und Gelegenheit sein, – bei aller
gebotenen Kürze – etwas intensiver auf das Werk einer Künstlerin zu schauen,
die der Porzellangestaltung ganz neue Wege gewiesen hat. In meinen Augen hat
sie zumindest in Europa – die Entwicklung in den USA und Japan überblicke ich
zu wenig – nicht ihresgleichen. Dass ihr Werk nun hier, an diesem für das Thema
Porzellan zentralen Ort ausgestellt wird, rückt es in ein besonderes, man
könnte auch sagen in das ihm zukommende Licht. Ich sage das so, obwohl ich
Karen Müller schon abwehrend die Hand heben sehe. Ich werde also begründen müssen,
warum ich sie, wenigstens in Europa, für die wichtigste Künstlerin halte, die
heute mit Porzellan arbeitet. Meine Behauptung ist, dass sie diesem Werkstoff
eine neue Dimension erschlossen hat, und damit meine ich nicht in erster Linie
die messbare Größe ihrer Arbeiten, obwohl auch die eine Rolle spielt. Darüber
wird noch zu sprechen sein.
Ich versuche eine erste Annäherung über Karen Müllers Biographie, die anders verlaufen wäre, wenn sie, die auf einem großen Gutshof an der Nordsee aufgewachsen ist, nach Abschluss ihrer landwirtschaftlichen Lehre nicht als Feriengast in die Elmau gekommen wäre. Dort lernte sie den Silberschmied Frank Müller kennen. Als die beiden 1959 heirateten, war sie zwanzig. Elmau, dieses abgeschlossene Hochtal am Fuß des Wettersteins zwischen Garmisch und Mittenwald, in dem der Theologe Johannes Müller, der Großvater von Frank, Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem Geist der Lebensreform ein schlossartiges Refugium errichtet hatte, dessen besondere Atmosphäre Jahr für Jahr zahlreiche Gäste anlockte – Elmau wurde Karen Müllers neue Heimat. Es müsste genauer heißen: dort baute sie sich eine neue Heimat auf, und das ist ganz wörtlich zu verstehen. Denn die junge Familie lebte nicht etwa im Schloss, sondern abseits in einem kleinen Waschhaus, das nach und nach als Wohn- und Arbeitsplatz um- und ausgebaut wurde. Mit ihren Händen zu arbeiten, war Karen Müller von Kind an gewohnt. Daher fand sie sich, was nicht einfach war, auch in ihrem neuen Leben zurecht. Wichtig wurden für sie künstlerische Anregungen: neben der Arbeit ihres Mannes die Ermunterung durch ihren Schwager, den Maler Gerhard Fietz, als Mitbegründer der Künstlergruppe ZEN 49 einer der bedeutenden Vertreter der gegenstandslosen Malerei in Deutschland. In München lernte sie die kunst- und spielpädagogischen Initiativen einer Gruppe junger Kunsterzieher kennen, die Kindern und Jugendlichen neue Lern- und Erlebnisorte außerhalb des eingefahrenen Kunstunterrichts an den Schule anboten, was ihr Interesse weckte und sie anregte, mit den eigenen und fremden Kindern zu malen und zu töpfern. Und sie entdeckte die Schwarzweißfotografie als Medium, in das sie sich lang und mit Leidenschaft vertiefte.
Das
Terrain war also schon gut vorbereitet, als Karen Müller 1971 die fast 40 Jahre
ältere Anna de Carmel traf. Diese Begegnung sollte nach der Entscheidung für
Elmau der zweite entscheidende Wendepunkt in ihrem Leben werden. Anna de Carmel
hatte in den 1920er Jahren bei dem Keramiker und Bildhauer Michael Powolny an der Kunstgewerbeschule in Wien studiert,
war als Jüdin 1938 nach dem „Anschluss“ Österreichs in die USA geflohen und
hatte dort wieder als Töpferin und Kunsthandwerkerin gearbeitet. Nun verbrachte
sie mit ihrem dritten Mann, dem Architekten Felix Augenfeld, jedes Jahr einige
Zeit in Europa, hauptsächlich in London, wo die beiden eine Wohnung in
Kensington hatten und einen großen Bekanntenkreis vor allem jüdischer
Emigranten um sich versammelten. Aber sie kamen eben auch nach Elmau, wo sie
Karen Müller begegneten, mit der sie bald eine tiefe Freundschaft verband. Anna
de Carmel hat offenbar sehr schnell erkannt, welche Begabungen in der jungen
Frau schlummerten, und hat ihr den Weg zur Keramik gewiesen.
Ehe sie ihn wirklich betreten konnte – mit Drehen und Glasieren hatte sie sich schon im Rahmen ihrer Kindermalschule befasst –, vergingen einige Jahre. Denn eines war Karen Müller von Anfang an klar: sie wollte eine professionelle Ausbildung. Das durchzusetzen, war nicht leicht, denn einmal war sie über das Alter, in dem man üblicherweise eine Lehre beginnt, längst hinaus, zum andern musste der Ausbildungsort wegen der Kinder in der Nähe liegen. Da traf es sich gut, dass eine Töpferei in Unterammergau eine Stelle frei hatte und sie 1976 als Lehrling aufnahm. 1979 legte sie in der Akademie der bildenden Künste in München die Gesellenprüfung ab und konnte nun daran gehen, ihre eigene Werkstatt aufzubauen.
Ihr Vorbild war Lucie Rie. Anna de Carmel hatte sie bei der Grande Dame der englischen Keramik eingeführt, die an der Wiener Kunstgewerbeschule ihre Kommilitonin gewesen war und, Jüdin wie Anne de Carmel, 1938 nach London emigriert war. Karen Müller hat sie seit 1980 bis zu ihrem Tod 1995 immer wieder besucht. Was sie an Lucie Rie faszinierte, war neben der Vollkommenheit ihrer zartwandigen Gefäße die Konsequenz, mit der sie ihren künstlerischen Weg verfolgt hatte, ihre Bescheidenheit und nicht zuletzt die Offenheit, mit der sie der Jüngeren begegnete und ihr Orientierung bot. Von ihr wurde sie in der Entschlossenheit bestärkt, den eigenen Weg zu finden, dabei an sich selbst den höchsten Anspruch zu stellen und diesem stets treu zu bleiben.
Dass sie nicht auf dem Pfad volkstümlicher Töpferei fortschreiten wollte, die sie in ihrer Lehrzeit kennengelernt hatte, stand für Karen Müller von Anfang an fest. Was sie, wie die meisten Keramiker, die in 1980er Jahren die „neue Keramik“ verkörperten, interessierte, waren hoch gebranntes Steinzeug und schon bald, schließlich fast ausschließlich Porzellan. Die dafür nötigen Kenntnisse auf dem Gebiet der Physik und Silikatchemie eignete sie sich in intensivem Selbststudium an. Anders als die meisten ihrer Zeitgenossen lockten sie aber nicht die Glasureffekte, die mit hohen Brenntemperaturen möglich sind. Porzellan erscheint bei ihr nicht als zarter transparenter Scherben oder Träger edler Glasuren. Es fehlt ihm der Glanz, der sich üblicherweise mit der Vorstellung von diesem Werkstoff verbindet. Karen Müller geht es nicht um die Haut, sondern um den Körper.
Das mag der Begegnung mit Lucie Rie geschuldet sein, die bei ihren Steinzeuggefäßen zwar nicht auf Glasur verzichtet, sich aber häufig auf ein gebrochenes Weiß oder helles Grau beschränkt. Diese Feldspatglasuren bilden matte, oft wie verwittert oder wie erstarrte Lava wirkende Oberflächen, deren haptische Qualität die Form der Gefäße als eine begreifbare, nicht nur anschauliche, sich dem Auge darbietende Größe erfahrbar macht. Lucie Ries Formenrepertoire ist vielfältig, es umfasst neben Schalen auf meistens kleiner Bodenfläche vor allem Vasen mit langem, engem Hals, der in einer weit ausladenden Lippe endet.
Dagegen ist bei Karen Müller Gefäß, von wenigen Ausnahmen abgesehen, gleichbedeutend mit Schale. Aber auch – oder gerade – bei ihr wollen die Stücke nicht nur betrachtet, sondern in die Hand genommen werden (was in der Ausstellung natürlich nicht möglich ist), ja sie wollen, sobald man an die ganz großen Formate mit 70 cm und mehr Durchmesser kommt, eigentlich mit dem ganzen Körper erlebt werden, denn um sie anzuheben und zu tragen, muss man die Arme ausbreiten und die Muskeln anspannen. Aber bitte mit Vorsicht! Diese herkömmliche Dimensionen sprengenden Gefäßen sind nämlich dünnwandig und entsprechend empfindlich. Aber sie können, um den Titel einer Sonderschau der Internationalen Handwerksmesse zu zitieren, zu der Karen Müller 1984 eingeladen war – sie können einen nachhaltigen Eindruck „Vom haptischen Vergnügen am Kunsthandwerk“ vermitteln. Man kann die verschiedene Sinne ansprechende Begegnung sogar noch ausweiten, indem man die großen Schalen anschlägt: Sie klingen voll und tief wie ein Gong. Vielleicht kommt man im Lauschen auf diesen Klang ihrer geheimnisvollen Schönheit am nächsten. (Auch darauf müssen Sie, meine Damen und Herren, in der Ausstellung leider verzichten.)
Lassen Sie mich noch ein wenig bei den Schalen verweilen, die lange Zeit so etwas wie das Markenzeichen der Künstlerin waren. Sie haben Karen Müller bekannt gemacht, für sie ist sie mit Preisen ausgezeichnet worden. Dass es sich nicht um Gebrauchskeramik handelt, versteht sich fast von selbst. Es wird vollends klar, wenn man beachtet, dass diese Schalen kaum jemals als Solitäre auftreten, sondern fast immer in Gruppen, bevorzugt als Paare. Karen Müller hat das selbst schon 1986 in einem Gespräch betont: „In meiner Arbeit beschäftigt mich sehr das ‚Paar’“, sagt sie da. „Einmal um der Willkür in diesem Beruf keine zu große Chance zu geben und zum andern ein Miteinander, ein Zueinander, ein Gegenüber, eine Begegnung, eine Konfrontation auszudrücken.“ Diese Zuordnung geschieht meistens auf subtile Weise, etwa indem eine Umrisslinie aufgenommen wird oder zwei Körper in einem bestimmten Winkel gegeneinander geneigt sind. Als Beispiele nenne ich Schalen mit auslappenden Rändern, die sich – mit größter Präzision gedreht – ineinandergestellt wie eine offene Blüte darbieten oder sich wie eine aufspringende Knospe entfalten; andere scheinen nebeneinandergereiht mit der Dünung des Meeren zu schwingen. Zwischen solchen Formen herrscht, anders als zwischen Teilen einer industriell gefertigten Serie, keine exakt in Zahlenverhältnisse fassbare, vielmehr eine lebendige, sich auch verändernde Beziehung. Das tritt am deutlichsten zutage bei Paaren oder Familien von Schalen, die durch einen exzentrischen Schwerpunkt gegeneinander geneigt sind. Sie befinden sich in einem labilen Gleichgewicht, das sich nur vorübergehend in einer Ruhelage einpendelt.
Wenn man möchte, kann man darin, ohne das Bild zu überanstrengen, eine Aussage über menschliche Beziehungen und deren Gefährdungen sehen. Der zitierte Satz, in dem von Begegnung und Konfrontation die Rede ist, legt diese Interpretation nahe. Sie wird durch Karen Müllers plastisches Werk bestätigt, in dem es ebenso wie bei den Schalen kaum Einzelfiguren gibt.
Die Plastik – und das unterscheidet Karen Müllers Werk von dem der meisten ihrer Zeitgenossen – steht bei ihr von Anfang an, beginnend mit an Daumier erinnernden Charakterköpfen, die sie an der Münchner Akademie modelliert hat, gleichberechtigt neben der Gefäßkeramik. Es gibt zwischen beiden keinen durch die Herkunft aus verschiedenen Traditionen begründeten Rangunterschied. Auch mit ihren Schalen macht Karen Müller, wie ich zu zeigen versucht habe, eine Aussage. Sie ist – wenn man die Bezeichnung nicht auf die Herstellung von Geschirr beschränken will – Töpferin – dieses Handwerk hat sie gelernt – und sie ist – auch wenn sie selbst vermeidet, sich so zu nennen – Bildhauerin. Als solche widmet sie sich fast ausschließlich einem Thema, der menschlichen Figur.
Es gibt ein paar Ausnahmen. Zu diesen zählt der Marktbrunnen in Kloster Heggbach bei Ulm. Er ist Karen Müllers erstes Werk im öffentlichen Raum, Ergebnis eines 1981 aus Anlass der 750-Jahrfeier des Klosters ausgeschriebenen Wettbewerbs, den die damals noch unbekannte Künstlerin gegen starke Konkurrenz gewonnen hat. Als Thema wählte sie, dem Ordensvater des seit 1884 von Franziskanerinnen besiedelten Klosters Reverenz erweisend, die Vogelpredigt des hl. Franz von Assisi. An der Wand des Brunnenhauses drängt sich eine Schar von Tauben, in Form und Größe einander sehr ähnlich, aber in Einzelheiten doch unterschieden. Sie sind aus weitgehend identischen gedrehten Formen entwickelt und individuell ausgestaltet. Mit diesem Verfahren, das sie bei ihren plastischen Arbeiten für die nächsten zehn Jahre beibehalten wird, gibt Karen Müller sich als Töpferin zu erkennen. Die Verbindung zu diesem traditionellen Handwerk ist ihr offenbar wichtig, auch wenn sie technisches und gestalterisches Neuland betritt. Beides ist, wie der Fortgang ihres Werkes zeigen wird, nicht voneinander zu trennen.
Die
Vögel des Heggbacher Marktbrunnens bestehen noch aus Steinzeug. Seit Mitte der
1980er Jahre wird dieses Material fast ganz vom Porzellan abgelöst. Zunächst
bleibt Karen Müller aber dabei, die Ausgangsformen ihrer Figuren auf der
Töpferscheibe zu drehen. Diese Herkunft sieht man auch den durch Stauchen und
Zusammendrücken in Form gebrachten Stücken an:
Die Künstlerin lässt die Drehrillen bewusst stehen, ja hebt sie durch sparsames Einreiben von Metalloxiden und Sinterengoben noch hervor. Auf Glasur verzichtet sie. Wo sie Farbe einsetzt – und das geschieht anfangs nur sparsam – , greift sie zu Oxiden, vor allem zu Kobalt- und Kupferoxid, die sie der Porzellanmasse beimengt. Das ergibt eine ganz andere Farbwirkung als das Auftragen farbiger Glasuren. Beim Drehen auf der Töpferscheibe vermischen sich die unterschiedlich eingefärbten Massen ähnlich wie der helle und der dunkle Teig bei einem Marmorkuchen. Das Ergebnis wird allerdings – im Unterschied zum Kuchen – erst nach dem Brand sichtbar. Anders als in der herkömmlichen glasierten Keramik fallen bei den so entstehenden Figuren – und den auf dieselbe Weise hergestellten Schalen – die Prozesse der Formgebung und der Farbgebung zusammen. Die Bewegung des Hochziehens auf der Töpferscheibe ist an den Farbverläufen wie in einer Momentaufnahme sichtbar. Was sich hier so leicht wie Kuchenbacken anhört, setzt, das muss betont werden, eine in langen Versuchsreihen erarbeitete Materialkenntnis voraus, die das unterschiedliche Verhalten gefärbter und ungefärbter Massen beim Drehen und beim Brand berücksichtigt und durch die Beigabe von Porzellanschamotte in wechselnden Anteilen Schmelzpunkt und Schwindung der verschiedenen Massen einander angleicht.
Ich will es bei dieser Andeutung technischer Probleme bewenden lassen. Dass Porzellan, insbesondere Hartporzellan mit seinem hohen Kaolinanteil (50%), wie Karen Müller es verwendet – dass diese Diva unter den keramischen Werkstoffen, launenhaft und in ihren Reaktionen kaum vorhersehbar ist, weiß jeder, der sich mit ihr eingelassen hat. Karen Müller hat über sie gesagt: „Wer Porzellan formen will, muss wissen, dass er es nicht beherrschen kann, sondern seiner Eigenart und seinem Rhythmus folgen muss.“ Vielleicht kommt ihr dabei entgegen, dass sie eine leidenschaftliche Tänzerin ist. Als sie daran ging, die „Vier Elemente“ für das Forschungszentrum von Roche in Penzberg zu formen, hatte sie gerade eine sich über vier Jahre hinziehende, in Buenos Aires vertiefte Tangolehrerausbildung abgeschlossen; diese war ihr wichtig, nicht weil sie unterrichten wollte – das hatte sie nie vor – sondern weil sie wusste: „ Ich brauche den aktiven Tanz, um meine schwere Arbeit machen zu können.“
Mit den – wiederum aus einem Wettbewerb hervorgegangenen – „Vier Elementen“ war in Karen Müllers Werk eine neue Stufe erreicht. Sie hatte Voraussetzungen, die kurz beleuchtet werden sollen, ehe ich auf Karen Müllers große Porzellanfiguren eingehe. Seit 1990 stand der Künstlerin ein zweites Atelier im Château de Nointel bei Paris zur Verfügung, wo sie bis 1999 jedes Jahr einige Monate zubrachte. Nach Paris zu gehen, bedeutete für sie wie für viele Künstler vor ihr einen Aufbruch, der mehr war als ein bloßer Ortswechsel. Den Schritt nach Paris scheint sie – ähnlich wie den aus der Töpferwerkstatt in Unterammergau an die Akademie in München – als einen Akt der Befreiung empfunden haben.
Elmau, dieser trotz des Schlosses mit seinen zahlreichen Besuchern und der Touristen abgelegene Ort, den sie sehr schätzt und der ihr ja auch erhalten blieb, bekam ein Gegengewicht in der pulsierenden Großstadt. Hier bewegte sie sich – wieder – unter Künstlern und pflegte, wie vorher schon mit Gerhard Fietz und anderen den Austausch mit Malern; diesmal war es eine Gruppe jüngerer Maler um Dominique Henri Rousserie (*1960), denen sie sich anschloss, die sie ermutigten, selbst zu malen, und ihr mit technischen Ratschlägen zur Seite standen. Man traf sich einmal in der Woche zum Aktstudium. Paris löste in Karen Müller einen kreativen Schub aus. Es entstanden zahlreiche großformatige Bilder, die sie bescheiden Skizzen nannte und nach einer ersten Präsentation in Paris lange Zeit vor der Öffentlichkeit zurückhielt; erst 2002 wurden sie im Gerhard-Fietz-Haus in Göddingen erneut ausgestellt.
Paris war, wenn Sie so wollen, der dritte Wendepunkt in Karen Müllers Leben. Zu der handwerklichen Meisterschaft, die sie sich als Keramikerin erworben hatte, kam nun ein neuer Ausdruckswille, der sie in neue Bilderwelten führte. Ihre Arbeiten, die immer einen oftmals nur untergründigen und nicht sofort erkennbaren Bezug zu ihrem Leben hatten, werden „literarischer“, erzählen Geschichten, zum Teil alte Geschichten, die unerwartete Aktualität bekommen. Mit den neuen Inhalten erhält auch das Porzellan einen anderen Charakter. Er äußert sich nicht zuletzt in den großen Formaten, an die Karen Müller sich nun wagt.
Die oft beinahe lebensgroßen Figuren, die seit Mitte der 1990er Jahre entstehen, sind nicht mehr auf der Scheibe gedreht, sondern aus Platten aufgebaut, modelliert und dann mit Kanthölzern in ihre endgültige Form geschlagen. Diese Behandlung dient der Stabilisierung der Masse, prägt aber zugleich – und das ist ganz wörtlich zu nehmen – die Oberfläche der Figuren. Denn wie vordem die Drehrillen bleiben auch diese Arbeitsspuren erhalten. Sie wirken wie Verletzungen und sind in vielen Fällen auch so gemeint. Die fertigen Figuren werden wie alle Porzellane zweimal gebrannt. Beim Glattbrand erreicht die Temperatur 1.300° C, wodurch das Material steigenden Spannungen ausgesetzt wird, so dass es geschehen kann, dass die dünnwandige und große Form der Hitzeenergie nicht mehr standhält. Diese Erfahrung hat Johann Joachim Kaendler in Meißen bei seinen großen Tierfiguren schon 1731 gemacht. Damals versuchte man die Brandrisse irgendwie zu kaschieren. Anders Karen Müller. Sie betont zwar, dass „die Form den Brand grundsätzlich heil“ verlassen soll, „an bestimmten Stellen jedoch rissig, brüchig und vom Feuer gezeichnet“ sein darf, ja sein soll.
Makelloses Weiß hatte man schon vorher bei ihren Porzellanen kaum gefunden. Nun verschwindet es ganz. Wenn man nicht wüsste, dass ihre Plastiken aus Porzellan gefertigt sind, würde man bei ihrem Anblick in vielen Fällen nicht an diesen Werkstoff denken.
Ihre zerklüftete Oberfläche mit der fremdartigen, oft metallisch schimmernden Farbigkeit ist weit entfernt von allem, was man gemeinhin mit Porzellan in Verbindung bringt. Nach dem ersten, dem Schrühbrand werden die Oberflächen nämlich mit Engoben und verschiedenen Oxiden eingerieben, die beim Glattbrand in reduzierender Atmosphäre in Metalle umgewandelt werden. Diese können schließlich aufpoliert werden und erhalten einen metallischen Glanz. In Verbindung mit der matten Farbigkeit der Engoben und dem Spiel von Licht und Schatten auf der von Rissen und Furchen durchzogenen Oberfläche verleiht er den Figuren eine Qualität, wie man sie von der – in den meisten Fällen glasierten – Porzellanplastik nicht kannte.
Die Ahnenreihe dieser Figuren findet sich in der modernen Plastik, soweit diese – angefangen mit Rodin –an der menschlichen Gestalt festgehalten, sie aber häufig fragmentiert hat, so dass man den Torso geradezu als ihr Leitmotiv bezeichnen kann (Siegmar Holsten). Karen Müller nimmt dieses Leitmotiv auf und stellt sich damit in eine Tradition, eine vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart reichende Entwicklungslinie, zu der es in vielen Fällen auch gehört, dass Arbeitsspuren nicht getilgt werden, sondern als Zerlegung der Oberfläche eigenen Wert gewinnen. Sie sind charakteristisch für eine Kunst, die von der Wiedergabe der Erscheinung zum Wesen der Dinge vordringen will. Im Fall der figurativen Plastik bedeutet das vielfach auch, in archetypischen Bildern der menschlichen Existenz und ihrer ständigen Gefährdung auf den Grund kommen zu wollen.
Wie Karen Müller es tut, wenn sie in ihren Werken immer wieder dieselben Fragen stellt: Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wie kommunizieren wir? Man begegnet diesen Fragen in vielen ihrer Figurengruppen, unübersehbar dann in den großen Zyklen Acht Tage und Der Mensch als solcher – Schemen, Stationen, die sie 2003 im Schloss Bellevue in Berlin bzw. 2005 in der Max-Planck-Gesellschaft in München zeigte und mit denen sie nichts Geringeres als eine sehr persönliche Interpretation des biblischen Schöpfungsmythos und der Menschheitsgeschichte unternahm. Mit diesen großen Werken trat sie – letzte Konsequenz ihrer Pariser Erfahrungen – endgültig aus dem engen Kreis der Keramik heraus. Das Leben, das sie in Paris geführt hatte, die Anerkennung, die sie unter Künstlern und in Kreisen kunstinteressierter Sammler gefunden hatte, deren Focus nicht auf die Keramik gerichtet war, scheint ihr Selbstvertrauen entscheidend gefördert zu haben. Sie wusste auch vorher, was sie konnte, hatte Anerkennung gefunden und war mit Preisen ausgezeichnet worden, aber in Paris ließ sie den mehr oder weniger abgeschlossenen Kreis der Keramik hinter sich. Seitdem nimmt sie sich die Freiheit, die überkommenen Gattungsgrenzen einfach zu missachten;
sie malt, sie formt, sie dreht auf der Töpferscheibe. Ihre Bilder (Skizzen), Figuren und Schalen sind gleichberechtigte und eng aufeinander bezogene Teile ihres Werks. Das wird in den erwähnten großen Zyklen besonders augenfällig.
Trotzdem ist es gerechtfertigt, ihr Werk gerade hier, im Porzellanikon, auszustellen. Denn Porzellan ist und bleibt die Basis dieses beeindruckenden Werks. Diesem Werkstoff hat Karen Müller neue Seiten abgewonnen, wie man sie vorher nicht gesehen hat. Gedrehte Schalen in dieser Größe hat es zuvor nicht gegeben. Dabei ging es Karen Müller freilich nie darum, Eingang ins Guinness Buch der Rekorde finden. Sie wollte die uranfängliche Geste des Auffangens und Ausgießens, dieses Wechselspiel von Ruhe und Bewegung, in seiner kosmischen Dimension anschaulich werden lassen. In der großen, innen vergoldeten Lichtschale, die in Karen Müllers Schöpfungszyklus dem ersten Tag zugeordnet ist, hat diese Vorstellung ihren stärksten Ausdruck gefunden.
Dazu kommt die Porzellanplastik, die den Bemühungen bedeutender Bildhauer und engagierter Manufakturen zum Trotz – ich erinnere an die Editionen von Rosenthal und Goebel, die in den 1980er Jahren auch an diesem Ort zu sehen waren – allen diesen Bemühungen zum Trotz, konnte sich die Porzellanplastik von Winckelmanns Verdikt: „Das mehrste Porzellan ist in lächerlichen Puppen geformt“, nie ganz frei machen. Karen Müller ist das – durch kleinere Arbeiten vorbereitet – mit den lebensgroßen Büsten der Vier Elemente 2001 endlich gelungen. Sie markieren in meinen Augen einen Durchbruch, der die Porzellanplastik – ähnlich wie Gertraud Möhwald die keramische Plastik – an einen den klassischen Werkstoffen Bronze, Stein und Holz gleichwertigen Platz im Olymp der Bildhauerkunst gerückt hat. Diesen Figuren folgten in den nächsten Jahren noch viele in unterschiedlichen Formaten. Sie werden ihnen in der Ausstellung begegnen. Dabei zeigt sich, dass Monumentalität und Ausdruckskraft nicht von der Größe der Figuren abhängen. Betrachten Sie dazu eine von Karen Müllers neueren Arbeiten: Die neun Musen unter der Führung Apolls sind bei ihr strenge, fast unnahbare Gottheiten; dass sie, wie Hesiod in der Theogonie berichtet, „um die dunkelfarbige Quelle mit leichtem Fuß tanzen“, kann man sich schwer vorstellen. Mit „lächerlichen Puppen“ wird man sie aber auch nicht verwechseln können. Ob sie das Entzücken Johann Joachim Winckelmanns erregt hätten, scheint höchst zweifelhaft. Er hätte sie wahrscheinlich lieber gesehen, wie sie, „wenn sie den glatten Leib im Permessos gebadet haben / oder in der Hippokrene oder dem gotterfüllten Olmeios, / tanzen […] auf dem Gipfel des Helikon ihre Reigen, / schöne und liebliche.“ Karen Müllers Musen, die „rechtredenden Töchter des großen Zeus“, sind nicht dem Ideal klassischer Schönheit verpflichtet, gehören eher einer archaischen Welt an. Vielleicht stehen sie uns deshalb nahe. Vielleicht berührt uns deshalb das Werk dieser Künstlerin, weil es, auch wo es – und das tut es immer wieder – Bilder aus der Vergangenheit beschwört, von uns Heutigen handelt.
© Peter Schmitt, Karlsruhe 2015